Wie kämpfen? Diese grosse Frage bringt die Corona-Krise mit neuer Dringlichkeit aufs Parkett. Gastautor M. Lautrèamont hat sich dazu grundsätzliche Gedanken gemacht und unterzieht einige aktuelle Erscheinungen des Linksradikalismus der Kritik.
Das Erstaunen war gross, als Anfang Mai 2020 in den Medien die Nachricht kursierte, dass in Genf 2500 Menschen stundenlang im Regen ausharrten, um kostenlose Lebensmittelpakete zu erhalten. Armut und Prekarität hierzulande? Das passt doch nicht ins Selbstbild der modernen Schweiz! Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass in Genf so viele Leute anstanden und auch in Zürich und Basel sind mit dem Fortschreiten der ökonomischen Krise immer mehr Leute auf kostenlose Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel angewiesen. Es ist kaum verwunderlich, dass aus dem bürgerlichen Lager die Bilder der kilometerlangen Menschenschlange kleingeredet wurden. Die noch miserablere Lage in anderen Ländern diente als willkommener Relativierungsfaktor.
Selbst der Nachklang all jener Stimmen von Aktivist*innen und marginalisierten Menschen, die seit Jahren versuchen mit dem ideologischen Selbstbild des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu brechen, schien im Strudel der sozialen Medien ungehört zu verhallen. Dass diejenigen Leute, die keine Aufenthaltsbewilligung haben oder dazu gezwungen sind, sich im Billiglohnsektor zu verdingen, am härtesten von den wirtschaftlichen Einbrüchen betroffen sein würden, war zu erwarten. Meist sind es migrantische Frauen – egal ob in einem formellen oder informellen Arbeitsverhältnis. Dass bürgerliche Politiker*innen die elende Situation so vieler Menschen relativieren, ist ebenfalls nicht überraschend. Überraschend ist einzig die Passivität der Linken und der Anarchist*innen. Auf analytischer Ebene erfassen sie zwar meistens die soziale Dimension der Corona-Krise, doch auf praktischer Ebene scheinen sie, mit einigen Ausnahmen, vollkommen gelähmt – und das nicht nur aufgrund der staatlichen Lockdown-Massnahmen.
Selbstreferenzieller Aktivismus
Es ist klar, dass die momentane Lage den Radius widerständiger Aktionen reduziert. Da sich aber eine ökonomische Krise anbahnt, täten Linke und Anarchist*innen gut daran, sich auf kommende Kämpfe vorzubereiten und die eigenen theoretischen und praxisbezogenen Mängel zu reflektieren. Die missliche Lage der selbsternannten Revolutionär*innen hierzulande hat Programm, weil die linksradikale und anarchistische Szene jahrzehntelang durch einen selbstreferenziellen Aktionismus gekennzeichnet war. Durch das momentane Ausbleiben einer revolutionären Massenbewegung und die Unmöglichkeit eines Aufstands sieht sich die revolutionäre Aktivist*in einmal mehr auf sich selbst und ihre Szene zurückgeworfen. Die Aufrechterhaltung dieser festgesetzten Rolle – die an ein radikales Auftreten, spezifische sprachliche Ausdrücke und ritualisierte Aktionsformen gekoppelt ist – wird im schlimmsten Fall zur identitätsstiftenden politischen Praxis und dreht sich nur noch um sich selbst. Dabei stellt sich die Frage, ob eine emanzipatorische politische Praxis den eigenen politischen Zusammenhang (egal ob Affinitätsgruppe oder grössere Organisation) oder die Bedürfnisse unserer Klasse ins Zentrum stellen sollte. All diese Einwände sind nichts Neues, doch sie sollten immer wieder aufgegriffen werde, solange die Probleme, auf die sie zielen und aufzeigen, bestehen. Denn der selbstreferenzielle Aktivismus ist Symptom einer Selbstisolation im Szenekuchen.
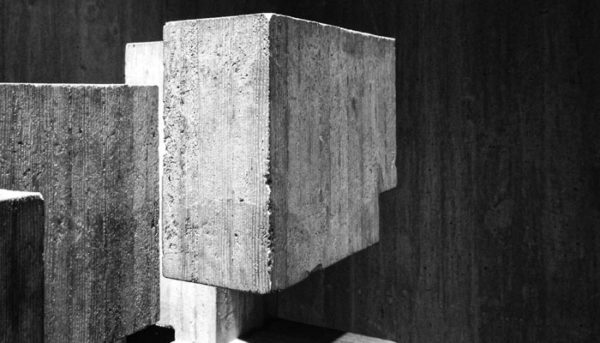
Selbst das, was als Theorie und Analyse begriffen wird, fungiert meist als Legitimationsideologie für die eigene Praxis und Selbstisolation. Während der selbstreferenzielle Aktionismus die Theorie als Legitimierung des eigenen Handelns missbraucht, rechtfertigen die Intellektuellen ihr Nichtstun mit Theoriearbeit. Wer sich nicht in die identitätsstiftende und spektakuläre Welt des Aktivismus stürzt, richtet sich eine kleine intellektuelle Nische ein, in der die Resignation mit einer Zurückweisung jeglicher Praxis einhergeht. Was schliesslich bis zu einer merkwürdigen Nachahmung des so verteufelten Akademismus führen kann. Wenn Intellektuelle um ihrer Intellektualität willen über die verallgemeinerte Misere des Kapitalismus sinnieren, scheinen sie eine radikale und sozial-revolutionäre Perspektive zu verteidigen. Ihre Kritik bleibt indes idealistisch, weil ihr jeglicher praktischer Handlungshorizont abhanden kommt oder gar nie anvisiert wurde.
So schwadronieren Aktivist*innen und Intellektuelle von der sozialen Revolution, als wäre sie ein rein voluntaristischer Akt der selbsternannten Revolutionär*innen. Diese sollen durch Handlungen oder Ideen, den revolutionären Geist der Arbeiter*innenklasse entfachen. Der holländische Rätekommunist Cajo Brendel kritisierte Ende der 1970er Jahre solche Positionen, als er festhielt, dass nicht diejenigen die Gesellschaft revolutionieren, die «nicht müde werden von einer sozialen ‹Revolution› zu reden», sondern jene, «welche bloss ihre materiellen Interessen verteidigen, ohne überhaupt eine Revolution zu beabsichtigen.»
Die Lage des hiesigen linksradikalen und anarchistischen Milieus ist zwar alles andere als vielversprechend. Aber wir müssen uns fragen: Wann soll es gelingen, die staaten- und klassenlose Gesellschaft international wieder als realistisches Ding der Unmöglichkeit zu positionieren, wenn nicht zu Zeiten, in denen selbst in der befriedeten Schweiz die Klassenwidersprüche in aller Deutlichkeit an die Oberfläche katapultiert werden?
Relativierungen und Ausnahmezustand
Selbstverständlich werden aus der aktuellen chaotischen Lage nicht automatisch emanzipatorische Kämpfe entstehen und die Gefahr, dass autoritäre und nationalistische Positionen noch mehr Aufschwung erhalten, ist gross. Es besteht auch die Möglichkeit, dass viele Leute sich vermehrt mit «Vater Staat» identifizieren, der seine «hilfsbedürftigen Bürger*innen» vor dem Virus und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Einbruch schützt. Passiv zu bleiben wäre aber ein grosser Fehler. Um über revolutionäre Interventionsmöglichkeiten nachzudenken, ist allerdings eine kritische Auseinandersetzung mit fragwürdigen gegenwärtigen Analysen unentbehrlich. Ansonsten leidet darunter auch die emanzipatorische Praxis.
Ende März dieses Jahres publizierte die Zeitung Le Monde ein Interview mit dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben, dessen Analyse zur Corona-Krise vielen anarchistischen Positionen ähnelt. Der 78-jährige Agamben schien sichtlich überfordert mit der aussergewöhnlichen Lage und hatte nichts Besseres zu tun, als die Pandemie kleinzureden und zu relativieren. Die Medien hätten Angst und Panik geschürt, das ganze Leben drehe sich nur noch um das blanke Überleben. Dies bilde einen perfekten Nährboden für den Autoritarismus im Namen der Gesundheit und der Sicherheit. Agamben ist zuzustimmen, dass die Eindämmungsmassnahmen einen autoritären Charakter haben. Genauso ist es Tatsache, dass Rechtsbeschränkungen schwer rückgängig gemacht werden können, sobald sie einmal implementiert worden sind. Doch die Pandemie als «Medienhysterie» zu bezeichnen und sie zu relativieren, indem sie implizit mit einer normalen Grippewelle verglichen wird und dabei auch noch eine pragmatische Abwägung zwischen bürgerlichen Freiheiten und der Gesundheit zu fordern, bedeutet, zu ignorieren, welche Konsequenzen unzähligen Lohnarbeiter*innen drohten.

Die einseitige Fokussierung auf das Vorgehen des Staates, abgekoppelt von wirtschaftlichen Prozessen, ist vor allem in anarchistischen Kreisen anzutreffen. Auch wenn eine Kritik des Agierens des Staates von enormer Wichtigkeit ist, wird durch eine einseitige Fokussierung auf diesen Aspekt nicht nur eine differenzierte Auseinandersetzung mit der aktuellen Lage vermieden, sondern die Pandemie selbst wird in postmodern anmutender Manier zu einem rein diskursiven Phänomen umdeklariert. Der argentinische Marxist Rolando Astarita fragt in diesem Kontext berechtigterweise: «Wenn alles eine ‹neoliberale Medienhysterie› ist, warum sollte man sich dann mit den materiellen, objektiven Bedingungen befassen, unter denen die Massen leben oder arbeiten und dem Virus ausgesetzt sind?»4
Auch der geforderte Pragmatismus Agambens konzentriert sich in diesem Sinne nur auf das Agieren des Staates, ohne zu beachten, dass im Umkehrschluss eine Zurückhaltung des Staates in Zeiten einer Pandemie einen grossen Teil der proletarisierten Massen dazu gezwungen hätte, die eigene Gesundheit – mehr noch als sonst – auf’s Spiel zu setzen. Arbeiter*innen in verschiedenen Ländern haben diese Gefahr erkannt und die Arbeit verweigert.
Eine Kritik an den staatlichen Massnahmen sollte es vermeiden, ins Fahrwasser der ewigen Apologet*innen des freien Marktes zu geraten, die im Namen der Freiheit ungeniert die Weiterführung der Ausbeutung fordern – egal was die gesundheitlichen Konsequenzen für die Arbeiter*innen sind: Wir sollen uns bis zum Umfallen als doppelt freie Lohnarbeiter*innen verdingen und unsere Gesundheit auf’s Spiel setzen. Das ist das blanke Überleben. Diejenigen hingegen, die vorübergehend von der Arbeit «befreit» sind, müssen um ihre Existenz bangen. Wer Glück hat, für den wird hierzulande Kurzarbeit angemeldet. Aber zwanzig Prozent weniger Lohn, ist für viele nur schwer zu verkraften. Im selben Zug fühlen sich viele, die bei vollem oder magerem Lohnausgleich zu Hause bleiben können, schlichtweg von der Gesellschaft ausgeschlossen, isoliert und überflüssig.
Wissenschaft und Gesundheit
Wie Tristan Leoni und Céline Alkamar in ihrem Artikel «Koste es, was es wolle. Der Virus, der Staat und wir» über die Situation in Frankreich schreiben – wo die staatlichen Massnahmen strenger sind als hierzulande – täten wir falsch daran, das staatliche Vorgehen im Zuge der Pandemie rein repressiv und machtpolitisch zu verstehen. Die gesundheitliche Dimension des ganzen Schlamassels darf nicht ausser Acht gelassen werden. Aus dem medizinischen Bereich wurden bereits vor dem Inkrafttreten der staatlichen Massnahmen in verschiedenen Ländern Stimmen laut, die eine möglichst schnelle und konsequente Einschränkung der wirtschaftlichen Normalität forderten. Aus Angst, den eigenen Wirtschaftsstandort zu gefährden, reagierten jedoch viele Staaten zunächst zögerlich. Das führte ironischerweise dazu, dass kurze Zeit später umso drastischere Massnahmen erforderlich wurden. Doch letzten Endes hatten die Massnahmen einen rationalen Kern: Auch in einer Gesellschaft ohne Staat, in einer vom Kapitalismus befreiten Gesellschaft, hätte man weitgehend auf Social-Distancing-Massnahmen zurückgreifen müssen, um die Pandemie einzudämmen. Die Massnahmen wären aber dann hoffentlich nicht von oben nach unten angeordnet worden und die physische Distanzierung wäre vermutlich an soziale Solidarität gekoppelt gewesen. Dies sei erwähnt, weil viele in ihrer Ablehnung gegen den Staat eine Anti-Haltung gegen die Eindämmungsmassnahmen einnehmen und das zugrundeliegende gesundheitliche Problem aus den Augen verlieren.

Dann gibt es noch diejenigen Anarchist*innen, die die Wissenschaft verteufeln (PDF) und dementsprechend praktisch alles, was Epidemolog*innen und Virolog*innen sagen, zurückweisen. Ihnen sei nur Folgendes gesagt: Aus meiner Sicht haben anti-wissenschaftliche Positionen zu diesem historischen Zeitpunkt mehr mit Verschwörungstheorien gemein als mit Bakunin. Dieser kritisierte zwar die unhinterfragte Autorität und Machtposition der Wissenschaft, gestand aber trotzdem ein, dass es Leute gibt, die in einem bestimmten Gebiet über mehr Wissen und Erfahrung verfügen als andere. Daraus folgt nicht, dass man sich unüberlegt der Expertise eines anderen zu unterwerfen hat, sondern, dass sich die eigene Position in der Auseinandersetzung mit Argumenten und verschiedenen Positionen entwickeln sollte. Eine Haltung, die davon ausgeht, dass alles, was nach institutionalisierter Autorität riecht, per se falsch ist, kann damit nicht begründet werden.
Aus meiner Sicht gehört also zu einer emanzipatorischen Praxis in Zeiten von Covid-19, die Pandemie nicht kleinzureden, die Verschlechterung der Lebensverhältnisse nicht zu ignorieren, kritisch gegenüber dem Vorgehen des Staates und seinen Institutionen zu bleiben, den Tod von Menschen nicht zu bagatellisieren und die Zwiespältigkeit der Forderung nach individueller Freiheit anzuerkennen – weil diese in der bürgerlichen Gesellschaft an die Freiheit des Marktes gekoppelt ist. Die Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität ist keine Freiheit.
Solidarität ist en vogue
Es käme einer Anmassung gleich, ein starres Konzept zu präsentieren, was aus sozialrevolutionärer Perspektive in diesem Moment zu tun ist. Doch einige der grundlegenden Säulen des Anarchismus in Erinnerung zu rufen ist essenziell: Selbstorganisation, gegenseitige Hilfe, Anti-autoritarismus und Solidarität. Die Frage ist nur, wie können diese Konzepte kombiniert werden, ohne Wohltätigkeitsarbeit nachzuahmen und wie kann daraus eine offensive Stärke entwickelt werden.
Es ist für Sozialrevolutionär*innen natürlich irritierend, zu sehen, wie die kleinen Ansätze von selbstorganisierter Solidarität, die Nachbarschaftshilfen, die Gabenzäune, die Essensausgaben, die Unterstützung für Geflüchtete oder arbeitsrechtliche Beratungen von Basisgruppen bis weit ins bürgerliche Lager hinein auf Sympathie stossen. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, mit unseren Ideen, Praktiken und Analysen versuchen in verschiedenen solidarischen Zusammenhängen zu intervenieren und uns über die Szeneschranken hinaus zu vernetzen. Sobald es die Zustände ermöglichen, ist es selbstverständlich auch wichtig, sich kollektiv den öffentlichen Raum wieder zu nehmen und gegen die sich anbahnende Verschlechterung unserer Lebensverhältnisse zu mobilisieren. Doch auch eine breitere Vernetzung an den Arbeitsplätzen und in den Quartieren dürfte von Bedeutung sein, um die auf uns zurollenden sozialen Angriffe zu bekämpfen.

Wir müssen versuchen, unsere gesellschaftliche Rolle als atomisierte Subjekte aufzuheben und uns über unsere subkulturellen Schranken hinweg zu vernetzten und mit Leuten zu solidarisieren, die nicht zu unserem linksradikalen und anarchistischen Milieu gehören. Natürlich kann es mühsam sein, wieder Grundsatzdiskussionen führen zu müssen, doch um einen antiautoritären, feministischen und antikapitalistischen Pol mittel- bis längerfristig zu etablieren, sollten wir solidarische Beziehungen und Strukturen quer durch die Gesellschaft aufbauen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Aufbau von Massenorganisationen und dem damit verbundenen Zahlenfetisch. Denken wir etwa an die chilenische Revolte, im Zuge derer sich Territorialversammlungen im ganzen Land verbreiteten: In ihnen sind Koordinierungsinstanzen entstanden, durch die unsere Klasse ihre Bedürfnisse artikulieren und die Befriedigung derselben organisieren kann – von der Solidarität im Quartier in Form von Essensverteilung und Voküs bis zur kollektiven Verteidigung gegen Bullenangriffe.
Die kollektive Selbstorganisation ist aus meiner Sicht auch hierzulande essenziell, um aus der aktuellen defensiven Lage herauszufinden. Das entspricht leider oft nicht dem Selbstbild vieler selbsternannter Revolutionär*innen, die Revolution bloss als Aufstand, Strassen-Action, Heldentum und hollywoodeske Inszenierung von Radikalität verstehen, anstatt als einen Prozess, in welchem neue soziale Beziehungen etabliert werden müssen. Dass beispielsweise Basisarbeit in vielen Fällen viel wichtiger ist, als sich selbst beim Farbanschlag zu filmen, kommt einer Banalität gleich. Doch als neoliberale Subjekte sehnen wir uns nur allzu oft eher nach dem Spektakel, als nach der Überwindung der eigenen Atomisierung. Um Missverständnisse zu vermeiden: Das soll nicht heissen, dass ich Militanz ablehne. Die Kritik gilt lediglich einer unreflektierten und selbstreferenziellen Militanz. Einige Anarchist*innen haben das bereits vor mir schön auf den Punkt gebracht: «Das Problem ist, dass jene, die denken, dass sie weiter vorne stehen und radikaler sind als die anderen, dies aus einem bestimmten Grund tun. In diesen Fällen liegt der Grund im Gebrauch von gewissen Instrumenten: diejenigen, die reden, schwatzen bloss, diejenigen, die bewaffnet angreifen, agieren. All diese perfekten bewaffneten Kämpfer haben sich in ihre Instrumente verliebt. Sie lieben sie so sehr, dass die Waffen aufhören, solche zu sein. Sie werden zum Selbstzweck, sie werden zum Daseinsgrund. Sie wählen nicht die für den Zweck am besten geeigneten Mittel, sie verwandeln das Mittel zum Zweck an sich.»
Die Zeiten sind scheisse, aber auch zu scheisse um zu resignieren. Und genau in Zeiten wie diesen sollten wir nicht vergessen, dass die soziale Revolution ein realistisches Ding der Unmöglichkeit ist.
Fotos: Uve Sanchez / Unsplash




